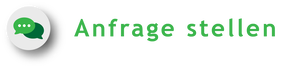Heizungswasseraufbereitung als Gewährleistungsfalle
Strategien für eine rechtssichere Vorgehensweise
GRUNDLAGEN UND VORGEHENSWEISEN
Strategien für eine rechtssichere Vorgehensweise
GRUNDLAGEN UND VORGEHENSWEISEN
| Heizungswasser als Gewährleistungsfalle | |
| File Size: | 156 kb |
| File Type: | |
GRUNDLAGEN
1. Es gibt nicht die einzig richtige Art der Füllwasseraufbereitung, sondern die Art der Füllwasseraufbereitung muss sich an der Anlage orientieren
(verbaute Materialien etc.).
2. Die Füllwasseraufbereitung erfolgt nicht nur einmal und dann ist die Aufgabe erledigt, sondern das Füllwasser muss laufend überwacht werden und
gegebenenfalls immer mal wieder angepasst werden.
3. Die Grundlage der Füllwasseraufbereitung für geschlossene Wärme- und Kältenetze ist sauerstoffarmes Wasser. Die VDI 2035 geht bei den empho-
lenen Aufbereitungsarten vom sauerstoffarmen Wasser aus. Ob das Wasser sauerstoffarm ist bzw. bleibt, hängt aber von der verbauten Technik ab.
4. Wenn das Füllwasser auf Dauer nicht sauerstoffarm bleibt, dann wird sich auch das Füllwasser laufend verändern. Somit sind dann einfache
Aufbereitungsmethoden wie z. B. die Vollentsalzung nicht mehr ausreichend.
5. Mobile Wasseraufbereitungsgeräte sind in der Regel nicht geeignet, um mit jeder möglichen Rohwasserqualität auch akzeptable Füllwasserqualitäten
vor Ort zu erzeugen.
6. Bevor ein Rohrleitungssystem bzw. Anlagennetz befüllt werden kann, muss es ausreichend gespült werden. Die Qualität des Spülwassers sollte dabei
dieselbe Qualität sein wie das eingesetzte Füllwasser.
7. Das Abdrücken oder die Zwischenbefüllung von Netzteilen sollte immer mit aufbereitetem Wasser erfolgen.
8. Nachspeiseeinheiten zur Nachbefüllung sollten so ausgelegt sein, dass diese auch von Laien gut bedient werden können. Es sollte sicher gestellt
werden, dass das Ergänzungswasser auch bei ungünstigen Bedingungen immer eine optimale Qualität hat.
9. Alle Maßnahmen (Auslegen, Spülen, Füllen, Nachspeisen) sollten ausreichend dokumentiert werden. Die Dokumentation sollte durch den Betreiber
abgenommen werden.
10. Die Parameter des Füllwassers beschränken sich nicht nur auf pH-Wert, elektrische Leitfähigkeit und Härte des Wassers. Um die Korrosivität des
Füllwassers bzw. die korrosiven Prozesse, die sich im Füllwasser widerspiegeln, bewerten zu können, sind Parameter wie Chloride, gelöste Metalle etc.
zwingend notwendig.
11. Die Füllwasserbestimmung mittels mobilen Messgeräten, ist nicht gerichtsfest und sehr ungenau. Nur Auswertungen, bei denen die Parameter von
einem zertifizierten Labor festgestellt werden, sind aussagekräftig und entsprechend gerichtsfest.
VORGEHENSWEISE
bei Bestandsanlagen, die umgebaut oder erweitert werden
Schritt 1:
Ermittlung der aktuellen Füllwasserwerte über ein geeignetes Labor.
Schritt 2:
Nach Vorlage der Füllwasserwerte muss der Korrosionsgrad ermittelt werden. Auf Basis des Korrosionsgrades sollte eine Empfehlung erfolgen, wie das bestehende Netz vor der Endbefüllung gespült werden soll. Dabei ist folgendes im Vorfeld festzustellen:
Reicht es aus, mit aufbereitetem Wasser zu spülen oder sollte die Anlage mittels chemischen Zusätzen gereinigt werden (Beizen)?
Schritt 3:
Schriftliche Ausarbeitung, welche Füllwasserqualit.t für das zu befüllende Netz (neuer Teil + alter Teil) zu verwenden ist. In der Ausarbeitung sind unter anderem folgende Punkte zu berücksichtigen:
> Verbaute Materialien
> Temperaturen
> Vorschädigungen des Bestandes
> Strömungsgeschwindigkeiten
> Art der Druckhaltung
> zu erwartende Stillstände / Betriebsart
> Überwachungsaufwand.
Schritt 4:
Spül- und Füllplan erstellen. In der Ausarbeitung sind folgende Punkte zu berücksichtigen Die Qualität des Spülwassers sollte identisch sein mit der Wasserqualität, die zur Befüllung verwendet wird.
Sind chemische Zusätze beim Spülen notwendig?
Bei bereits stark korrosiven Rohrleitungen sollte mit einem chemischen „Beizmittel“ gearbeitet werden, das die Oberflächenkorrosionen
sanft abträgt, ohne das Material anzugreifen. Druckspülungen mit Luftdruck sind zu vermeiden, da dadurch das Rohrleitungsmaterial zusätzlich geschädigt wird. Der Einsatz von Rohwasser sollte unter allen Umständen vermieden werden. Anlagenteile sollten nicht über mehrere Tage unbefüllt sein.Vor der endgültigen Befüllung sollten alle Kreise noch einmal ausgiebig mit aufbereitetem Wasser gespült werden. Das Spülen erfolgt Kreisweise. An jeder Endstelle und an jedem Wärme- oder Kälteabnehmer sollte ausreichend Wasser abgelassen werden.
Es sollten keine Pumpen oder Spülkompressoren eingesetzt werden, da sonst die Gefahr besteht, dass Partikel die natürlichen Schutzschichten des Metalls schädigen.
Schritt 5:
Spülen der Anlage. Jeder gespülte Kreis sollte einzeln in einem Spülprotokoll dokumentiert werden. Das Spülwasser sollte vor dem Spülen beprobt werden (Labor).
Schritt 6:
Füllen der Anlage. Jeder gefüllte Kreis sollte einzeln in einem Füllprotokoll dokumentiert werden. Das Fülllwasser sollte vor dem Befüllen beprobt werden (Labor), sofern keine Fertigmischung mit Datenblatt eingesetzt wird. Aus der befüllten Anlage sollte eine Wasserprobe (jeder Kreis einzeln) gezogen werden. Diese Probe sollte über ein Labor ausgewertet werden.
Das Ergebnis dieser Auswertung sollte im Füllprotokoll dokumentiert werden.
Schritt 7:
Nachkontrolle des Füllwassers ca. vier Wochen nach Temperierung des Systems. Der gelöste Sauerstoff sollte vor Ort mittels geeigneten Geräten gemessen werden. Sollten die Werte gemäß VDI 2035 nicht erreicht werden, ist die Anlage nicht bereit zur Übergabe. Ggf. muss dann die Druckhaltung
und Entgasung nachjustiert werden. Je Kreis sollte eine Wasserprobe gezogen werden. Die Werte sollten über ein geeignetes Labor ermittelt werden. Entsprechen die Werte nicht den Vorgaben der VDI 2035, ist die Anlage nicht bereit zur Übergabe. Sind alle Werte passend, können die Ergebnisse
in das Füllprotokoll übernommen werden. Die Anlage ist dann bereit zur Übergabe.
Schritt 8:
Überprüfung und Dokumentation der Nachspeiseeinheit. Es ist sicher zu stellen, dass die eingebaute Nachspeiseeinheit auch dem aktuellen Betriebskonzept entspricht und funktionsfähig ist.
Schritt 9:
Übergabe* der Anlage an den Betreiber. Alle Protokolle und Dokumentationen sollten zu einem Dokument zusammengefügt werden. Zusätzlich sollte eine Betriebsanweisung für das Füllwasser entwickelt werden, die den Betreiber in die Lage versetzt, die Füllwasserüberwachung gemäß den Normen zu vollziehen oder einen Dritten damit zu betrauen. Mit einzubeziehen sind verbaute Anlagen wie z.B. Schlammabscheider und Nachspeiseeinrichtungen.
bei Bestandsanlagen, die umgebaut oder erweitert werden
Schritt 1:
Ermittlung der aktuellen Füllwasserwerte über ein geeignetes Labor.
Schritt 2:
Nach Vorlage der Füllwasserwerte muss der Korrosionsgrad ermittelt werden. Auf Basis des Korrosionsgrades sollte eine Empfehlung erfolgen, wie das bestehende Netz vor der Endbefüllung gespült werden soll. Dabei ist folgendes im Vorfeld festzustellen:
Reicht es aus, mit aufbereitetem Wasser zu spülen oder sollte die Anlage mittels chemischen Zusätzen gereinigt werden (Beizen)?
Schritt 3:
Schriftliche Ausarbeitung, welche Füllwasserqualit.t für das zu befüllende Netz (neuer Teil + alter Teil) zu verwenden ist. In der Ausarbeitung sind unter anderem folgende Punkte zu berücksichtigen:
> Verbaute Materialien
> Temperaturen
> Vorschädigungen des Bestandes
> Strömungsgeschwindigkeiten
> Art der Druckhaltung
> zu erwartende Stillstände / Betriebsart
> Überwachungsaufwand.
Schritt 4:
Spül- und Füllplan erstellen. In der Ausarbeitung sind folgende Punkte zu berücksichtigen Die Qualität des Spülwassers sollte identisch sein mit der Wasserqualität, die zur Befüllung verwendet wird.
Sind chemische Zusätze beim Spülen notwendig?
Bei bereits stark korrosiven Rohrleitungen sollte mit einem chemischen „Beizmittel“ gearbeitet werden, das die Oberflächenkorrosionen
sanft abträgt, ohne das Material anzugreifen. Druckspülungen mit Luftdruck sind zu vermeiden, da dadurch das Rohrleitungsmaterial zusätzlich geschädigt wird. Der Einsatz von Rohwasser sollte unter allen Umständen vermieden werden. Anlagenteile sollten nicht über mehrere Tage unbefüllt sein.Vor der endgültigen Befüllung sollten alle Kreise noch einmal ausgiebig mit aufbereitetem Wasser gespült werden. Das Spülen erfolgt Kreisweise. An jeder Endstelle und an jedem Wärme- oder Kälteabnehmer sollte ausreichend Wasser abgelassen werden.
Es sollten keine Pumpen oder Spülkompressoren eingesetzt werden, da sonst die Gefahr besteht, dass Partikel die natürlichen Schutzschichten des Metalls schädigen.
Schritt 5:
Spülen der Anlage. Jeder gespülte Kreis sollte einzeln in einem Spülprotokoll dokumentiert werden. Das Spülwasser sollte vor dem Spülen beprobt werden (Labor).
Schritt 6:
Füllen der Anlage. Jeder gefüllte Kreis sollte einzeln in einem Füllprotokoll dokumentiert werden. Das Fülllwasser sollte vor dem Befüllen beprobt werden (Labor), sofern keine Fertigmischung mit Datenblatt eingesetzt wird. Aus der befüllten Anlage sollte eine Wasserprobe (jeder Kreis einzeln) gezogen werden. Diese Probe sollte über ein Labor ausgewertet werden.
Das Ergebnis dieser Auswertung sollte im Füllprotokoll dokumentiert werden.
Schritt 7:
Nachkontrolle des Füllwassers ca. vier Wochen nach Temperierung des Systems. Der gelöste Sauerstoff sollte vor Ort mittels geeigneten Geräten gemessen werden. Sollten die Werte gemäß VDI 2035 nicht erreicht werden, ist die Anlage nicht bereit zur Übergabe. Ggf. muss dann die Druckhaltung
und Entgasung nachjustiert werden. Je Kreis sollte eine Wasserprobe gezogen werden. Die Werte sollten über ein geeignetes Labor ermittelt werden. Entsprechen die Werte nicht den Vorgaben der VDI 2035, ist die Anlage nicht bereit zur Übergabe. Sind alle Werte passend, können die Ergebnisse
in das Füllprotokoll übernommen werden. Die Anlage ist dann bereit zur Übergabe.
Schritt 8:
Überprüfung und Dokumentation der Nachspeiseeinheit. Es ist sicher zu stellen, dass die eingebaute Nachspeiseeinheit auch dem aktuellen Betriebskonzept entspricht und funktionsfähig ist.
Schritt 9:
Übergabe* der Anlage an den Betreiber. Alle Protokolle und Dokumentationen sollten zu einem Dokument zusammengefügt werden. Zusätzlich sollte eine Betriebsanweisung für das Füllwasser entwickelt werden, die den Betreiber in die Lage versetzt, die Füllwasserüberwachung gemäß den Normen zu vollziehen oder einen Dritten damit zu betrauen. Mit einzubeziehen sind verbaute Anlagen wie z.B. Schlammabscheider und Nachspeiseeinrichtungen.
- Entwicklung eines Betriebsprotokolls als Vorlage, das dem Betreiber übergeben werden kann.
- Entwicklung und Übergabe eines schriftlichen Hinweises, dass die Anlage normgerecht gespült und befüllt wurde und dass die weitere Überwachung des Füllwassers nun dem Betreiber übergeben wird (Betreiberpflicht).
VORGEHENSWEISE
bei Neuanlagen
Schritt 1:
Schriftliche Ausarbeitung, welche Füllwasserqualität für das zu befüllende Netz zu verwenden ist. In der Ausarbeitung sind unter anderem folgende Punkte zu berücksichtigen:
> Verbaute Materialien
> Temperaturen
> Vorschädigungen des Bestandes
> Strömungsgeschwindigkeiten
> Art der Druckhaltung
> zu erwartende Stillstände / Betriebsart
> Überwachungsaufwand.
Schritt 2:
Schriftlichen Spül- und Füllplan erstellen. In der Ausarbeitung sind folgende Punkte zu berücksichtigen:
Die Qualität des Spülwassers sollte identisch sein mit der Wasserqualität, die zur Befüllung verwendet wird.
Der Einsatz von Rohwasser sollte unter allen Umständen vermieden werden. Anlagenteile sollten nicht über mehrere Tage unbefüllt sein. Vor der endgültigen Befüllung sollten alle Kreise noch einmal ausgiebig mit aufbereitetem Wasser gespült werden. Das Spülen erfolgt Kreisweise. An jeder Endstelle und an jedem Wärme- oder Kälteabnehmer sollte ausreichend Wasser abgelassen werden.
Es sollten keine Pumpen oder Spülkompressoren eingesetzt werden, da sonst die Gefahr besteht, dass Partikel die natürlichen Schutzschichten des Metalls schädigen.
Schritt 3:
Jeder gespülte Kreis sollte einzeln in einem Spülprotokoll dokumentiert werden. Das Spülwasser sollte vor dem Spülen beprobt werden (Labor).
Schritt 4:
Füllen der Anlage. Jeder gefüllte Kreis sollte einzeln in einem Füllprotokoll dokumentiert werden. Das Fülllwasser sollte vor dem Befüllen beprobt werden (Labor), sofern keine Fertigmischung mit Datenblatt eingesetzt wird. Aus der befüllten Anlage sollte eine Wasserprobe (jeder Kreis einzeln) gezogen werden. Diese Probe sollte über ein Labor ausgewertet werden.
Das Ergebnis dieser Auswertung sollte im Füllprotokoll dokumentiert werden.
Schritt 5:
Nachkontrolle des Füllwassers ca. vier Wochen nach Temperierung des Systems. Der gelöste Sauerstoff sollte vor Ort mittels geeigneten Geräten gemessen werden. Sollten die Werte gemäß VDI 2035 nicht erreicht werden, ist die Anlage nicht bereit zur Übergabe. Ggf. muss dann die Druckhaltung
und Entgasung nachjustiert werden. Je Kreis sollte eine Wasserprobe gezogen werden. Die Werte sollten über ein geeignetes Labor ermittelt werden. Entsprechen die Werte nicht den Vorgaben der VDI 2035, ist die Anlage nicht bereit zur Übergabe. Sind alle Werte passend, können die Ergebnisse
in das Füllprotokoll übernommen werden. Die Anlage ist dann bereit zur Übergabe.
Schritt 6:
Überprüfung und Dokumentation der Nachspeiseeinheit. Es ist sicher zu stellen, dass die eingebaute Nachspeiseeinheit auch dem aktuellen Betriebskonzept entspricht und funktionsfähig ist.
Schritt 7:
Übergabe* der Anlage an den Betreiber. Alle Protokolle und Dokumentationen sollten zu einem Dokument zusammengefügt werden. Zusätzlich sollte eine Betriebsanweisung für das Füllwasser entwickelt werden, die den Betreiber in die Lage versetzt, die Füllwasserüberwachung gemäß den Normen zu vollziehen oder einen Dritten damit zu betrauen. Mit einzubeziehen sind verbaute Anlagen wie z.B. Schlammabscheider und Nachspeiseeinrichtungen.
bei Neuanlagen
Schritt 1:
Schriftliche Ausarbeitung, welche Füllwasserqualität für das zu befüllende Netz zu verwenden ist. In der Ausarbeitung sind unter anderem folgende Punkte zu berücksichtigen:
> Verbaute Materialien
> Temperaturen
> Vorschädigungen des Bestandes
> Strömungsgeschwindigkeiten
> Art der Druckhaltung
> zu erwartende Stillstände / Betriebsart
> Überwachungsaufwand.
Schritt 2:
Schriftlichen Spül- und Füllplan erstellen. In der Ausarbeitung sind folgende Punkte zu berücksichtigen:
Die Qualität des Spülwassers sollte identisch sein mit der Wasserqualität, die zur Befüllung verwendet wird.
Der Einsatz von Rohwasser sollte unter allen Umständen vermieden werden. Anlagenteile sollten nicht über mehrere Tage unbefüllt sein. Vor der endgültigen Befüllung sollten alle Kreise noch einmal ausgiebig mit aufbereitetem Wasser gespült werden. Das Spülen erfolgt Kreisweise. An jeder Endstelle und an jedem Wärme- oder Kälteabnehmer sollte ausreichend Wasser abgelassen werden.
Es sollten keine Pumpen oder Spülkompressoren eingesetzt werden, da sonst die Gefahr besteht, dass Partikel die natürlichen Schutzschichten des Metalls schädigen.
Schritt 3:
Jeder gespülte Kreis sollte einzeln in einem Spülprotokoll dokumentiert werden. Das Spülwasser sollte vor dem Spülen beprobt werden (Labor).
Schritt 4:
Füllen der Anlage. Jeder gefüllte Kreis sollte einzeln in einem Füllprotokoll dokumentiert werden. Das Fülllwasser sollte vor dem Befüllen beprobt werden (Labor), sofern keine Fertigmischung mit Datenblatt eingesetzt wird. Aus der befüllten Anlage sollte eine Wasserprobe (jeder Kreis einzeln) gezogen werden. Diese Probe sollte über ein Labor ausgewertet werden.
Das Ergebnis dieser Auswertung sollte im Füllprotokoll dokumentiert werden.
Schritt 5:
Nachkontrolle des Füllwassers ca. vier Wochen nach Temperierung des Systems. Der gelöste Sauerstoff sollte vor Ort mittels geeigneten Geräten gemessen werden. Sollten die Werte gemäß VDI 2035 nicht erreicht werden, ist die Anlage nicht bereit zur Übergabe. Ggf. muss dann die Druckhaltung
und Entgasung nachjustiert werden. Je Kreis sollte eine Wasserprobe gezogen werden. Die Werte sollten über ein geeignetes Labor ermittelt werden. Entsprechen die Werte nicht den Vorgaben der VDI 2035, ist die Anlage nicht bereit zur Übergabe. Sind alle Werte passend, können die Ergebnisse
in das Füllprotokoll übernommen werden. Die Anlage ist dann bereit zur Übergabe.
Schritt 6:
Überprüfung und Dokumentation der Nachspeiseeinheit. Es ist sicher zu stellen, dass die eingebaute Nachspeiseeinheit auch dem aktuellen Betriebskonzept entspricht und funktionsfähig ist.
Schritt 7:
Übergabe* der Anlage an den Betreiber. Alle Protokolle und Dokumentationen sollten zu einem Dokument zusammengefügt werden. Zusätzlich sollte eine Betriebsanweisung für das Füllwasser entwickelt werden, die den Betreiber in die Lage versetzt, die Füllwasserüberwachung gemäß den Normen zu vollziehen oder einen Dritten damit zu betrauen. Mit einzubeziehen sind verbaute Anlagen wie z.B. Schlammabscheider und Nachspeiseeinrichtungen.
- Entwicklung eines Betriebsprotokolls als Vorlage, das dem Betreiber übergeben werden kann.
- Entwicklung und Übergabe eines schriftlichen Hinweises, dass die Anlage normgerecht gespült und befüllt wurde und dass die weitere Überwachung des Füllwassers nun dem Betreiber übergeben wird (Betreiberpflicht).
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Wir stehen Ihnen gerne mit fachlicher Kompetenz zur Verfügung.
Hinweis:
Wir beliefern ausschließlich Gewerbetreibende und keine Endverbraucher
Hinweis:
Wir beliefern ausschließlich Gewerbetreibende und keine Endverbraucher
Alpenlandheizungswasser KG
Terminalstraße Mitte 18 I 85356 München
[email protected]
Tel:: 0800 381 4202 I Fax: 0800 381 209
[email protected]
Tel:: 0800 381 4202 I Fax: 0800 381 209
Niederlassungen:
Hamburg: |
6th Floor / Millerntorplatz 1 20359 Hamburg |
Berlin: |
8th Floor / Europaplatz 2 10557 Berlin |
Dresden: |
Altmarkt 10D 01067 Dresden |
Wasserburg am Inn: |
Odelsham 10 83547 Babensham |
Oberviechtach: |
Schönseerstr. 45 92626 Oberviechtach |