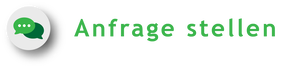Die Alpenland Heizungswasser KG informiert Sie zu folgenden Themen:
1. FAQ Entschlammung und Sanierung von geschlossenen Wärmenetzen und geschlossenen Kältenetzen
2. Technische Erläuterung zur Heizungswasserüberwachung
3. Merkblatt Überwachung der Wasserqualität bei Wärmenetzen
4. FAQ zu Angeboten
5. FAQ zum weiteren Vorgehen nach Bestellung und Auftragsbestätigung bei nicht oline getätigten Bestellungen
6. Beschwerdemanagement
1. FAQ Entschlammung und Sanierung von geschlossenen Wärmenetzen und geschlossenen Kältenetzen
F: Welche Ursachen sind für Korrosionsschlämme und Kalkablagerungen ursächlich?
A: Es gibt verschiedene Ursachen, die individuell (analagenspezifisch) ermittelt werden sollten. Die wesentlichsten Ursachen für starke Schlammbildungen sind:
- unzureichende Spülung vor der Befüllung
- unaufbereitetes Füllwasser oder falsch aufbereitetes Füllwasser (Das Füllwasser wurde nicht auf die verbauten Metallkombinationen abgestimmt
- unaufbereitetes Nachfüllwasser oder falsch aufbereitetes Nachfüllwasser
- zu hohe Sauerstoffeinträge
- zu hohe Nachfüllmengen (mehr als 10% des Fülwasservolumens bezogen auf die Lebenszeit der Anlage)
- Biofouling oder mikrobiell beeinflusste Korrosion (MIC) (Eingebrachte Keime bilden eine Biofilm und greifen das Metall an)
F: Welche Korrosionsarten sind für die Verschlammung verantwortlich?
A: Hierzu informiert die DIN EN 14868 und die ISO 8044. Die wesentlichsten Korrosionsarten sind laut VDI 2035 Blatt 2 folgende:
• gleichmäßige Flächenkorrosion
• Lochkorrosion
• Bimetallkorrosion
• Spaltkorrosion
• Korrosion unter Ablagerungen
• Wasserlinienkorrosion
• selektive Korrosion
• Erosionskorrosion
• Kavitationskorrosion
• Spannungsrisskorrosion
• mikrobiell beeinflusste Korrosion (MIC)
Schadensbild leichte Verschlammung
F: Welche Maßnahmen können bei leichten Verschlammungen ergriffen werden (wenig gelöste Metalle, geringe Leitfähigkeit, keine Biofilme)?
A: -Querspülen der Anlage mit aufbereitetem Wasser (Teilwasseraustausch) - Konditionieren des Füllwassers mit chemischen Korrosionsschutzmitteln - Einbau von Feinstfiltereinheiten zur um die überschüssigen Korrosionsabbauprodukten herauszufiltern - Optimierung der Druckhaltung um den Sauerstoffwert in den Sollbereich zu drosseln.
F: Kann auf die Querspülung verzichtet werden?
A: Dies ist nicht zu empfehlen, da der Großteil der Korrosionsabbauprodukte, so schnell wie möglich aus dem System entfernt werden sollten. Dies senkt zudem die elektrische Leitfähigkeit des Füllwassers.
F: Können die Korrosionsabbauprodukte alleine über einen Filter oder einen Schlammabscheider entfernt werden und kann man so das Querspülen sparen?
A: Dies ist nicht zu empfehlen, denn die gelösten Korrosionsabbauprodukte sind schwerer als Wasser und schwimmen schlecht. Dadurch kann nur ein geringer Teil der Korrosionsabbauprodukte in kurzer Zeit entfernt werden. Das Filtern ist aber als zusätzliche Maßnahme nach der Querspülung zu empfehlen um Wärmetauscher und enge Stellen zu schützen.
F: Reicht es das Anlagenwasser über einen Mischbettionentauscher (VE Patrone) zu entsalzen um die elektrische Leitfähigkeit zu mindern?
A: Dies ist nicht zu empfehlen, weil so die Korrosionsschlämme nicht entfernt werden. Die gelösten Metalle aus den Korrosionsabbauprodukten erhöhen kurzfristig die Leitfähigkeit wieder und der gewünschte Effekt bleibt aus.
F: Muss das Systemwasser mit chemischen Korrosionsschutzmitteln behandelt werden?
A: Dies hängt von der Materialkombination und von der Menge an gelöstem Sauerstoff im Systemwassser ab. Sollten die Sauerstoffvorgaben der VDI 2035 Blatt 2 nicht eingehalten werden können, so ist der Korrosionsschutz über die reine Wasseraufbereitung kaum möglich. In einem solchen Fall sollte der Korrosionsschutz über filmbildende Korrosionsschutzmittel erwogen werden.
F: In welchen Abständen sollte das Systemwasser überwacht werden?
A: Die VDI 2035 empfiehlt mindestens 1-mal jährlich.
F: Mit welcher Wasserqualität sollte die Anlage nachgefüllt werden?
A: Das Nachspeisewasser sollte dieselbe Qualität, wie das Füllwasser haben.
Schadensbild starke Verschlammung
F: Welche Maßnahmen können bei starken Verschlammungen ergriffen werden (z.B. große Mengen an gelösten Metallen, erhöhte Leitfähigkeit, Verdacht auf Biofilmbildung)?
A: - Einbringung chemischer Zusätze zur Lösung und zur Dispergation der Korrosionsablagerungen, der Biofilme
–Spülen und Füllen der Anlage mit aufbereitetem Wasser (2-3 Fache Wassermenge bezogen auf das Füllwasservolumen)
- Konditionieren des Füllwassers mit chemischen Korrosionsschutzmitteln
- Einbau von Feinstfiltereinheiten um die überschüssigen Korrosionsabbauprodukten herauszufiltern, die sich im Nachgang noch lösen
- Optimierung der Druckhaltung um den Sauerstoffwert in den Sollbereich zu drosseln
F: Kann auf die Behandlung mit chemischen Zusätzen zur Schlammlösung verzichtet werden?
A: Dies ist nicht zu empfehlen, da die Korrosionsabbauprodukte und Biofilme so schnell wie möglich aus dem System entfernt werden sollten. Das Spülen alleine mit Wasser führt so nicht zum gewünschten Erfolg.
F: Können die Korrosionsabbauprodukte alleine über einen Filter oder einen Schlammabscheider entfernt werden und kann man so das Querspülen sparen?
A: Dies ist nicht zu empfehlen, denn die gelösten Korrosionsabbauprodukte sind schwerer als Wasser und schwimmen schlecht. Somit kann nur ein geringer Teil der Korrosionsabbauprodukte in kurzer Zeit entfernt werden. Das Filtern ist aber als zusätzliche Maßnahme nach der Querspülung zu empfehlen um Wärmetauscher und enge Stellen zu schützen.
F: Reicht es das Anlagenwasser über einen Mischbettionentauscher (VE Patrone) zu entsalzen um die elektrische Leitfähigkeit zu mindern?
A: Dies ist nicht zu empfehlen, weil die Korrosionsschlämme so nicht entfernt werden. Die gelösten Metalle aus den Korrosionsabbauprodukten erhöhen kurzfristig die Leitfähigkeit wieder und der gewünschte Effekt bleibt aus.
F: Muss das Systemwasser mit chemischen Korrosionsschutzmitteln behandelt werden?
A: Dies hängt vom Grad der bereits vollzogenen Korrosionsschäden ab. Auch die Materialkombination bzw. die Menge an gelöstem Sauerstoff im Systemwassser ab spielen eine große Rolle. Sollten die Sauerstoffvorgaben der VDI 2035 Blatt 2 nicht eingehalten werden können, so ist der Korrosionsschutz über die reine Wasseraufbereitung kaum möglich. Dann sollte der Korrosionsschutz über filmbildende Korrosionsschutzmittel erwogen werden?
F: In welchen Abständen sollte das Systemwasser überwacht werden
A: Die VDI 2035 empfiehlt mindestens 1-mal jährlich.
F: Mit welcher Wasserqualität sollte die Anlage nachgefüllt werden
A: Das Nachspeisewasser sollte dieselbe Qualität, wie das Füllwasser haben.
2. Technische Erläuterung zur Heizungswasserüberwachung
Verantwortlichkeiten:
Für die laufende Überwachung des Heizungswassers ist der Betreiber des Wärmenetzes verantwortlich. Der Haustechniker ist hingegen für das normgerechte Spülen und das normgerechte Erstbefüllen des Wärmenetzes zuständig. www.normgerechtesheizungswasser.de
Übergabe der Verantwortung:
Der Haustechniker bzw. der verantwortliche Handwerker sollte seine Vorgehensweise dokumentieren und diese Protokolle nach dem normgerechten Spülen und Füllen des Wärmenetzes an den Betreiber übergeben. Anhand dieser Protokolle kann der Betreiber die angewendete Heizungswasseraufbereitung erkennen und die Überwachung des Heizungswasser bzw. die Beibehaltung dieser Qualität veranlassen.
Welche Werte des Heizungswasser gehören regelmäßig überprüft:
Je nach gewählter Fahrweise sollten die Wasserparameter eingehalten werden. Die wesentlichen Parameter sind der ph-Wert, der gelöste Sauerstoff, die elektrische Leitfähigkeit, die Gesamthärte. Wenn dem Füllwasser chemische Inhibitoren (korrosionshemmend) zugesetzt wurden, dann sollte auch die Konzentration dieser chemischen Inhibitoren regelmäßig überprüft werden.
Warum sollte das Heizungswasser regelmäßig überprüft werden:
Wichtig zu wissen ist, dass sich die Werte nach der Befüllung laufend verändern können. Hier spielen die Nachspeisemengen und die hier eingebrachte Wasserqualität, die Entgasung, die Temperatur eine wesentliche Rolle. Z.b beeinflusst die Menge an gelöstem Sauerstoff den ph-Wert. Auch Zeiten in denen das Wasser im Netz stagniert sind zu beachten, da hier Korrosionsraten sehr stark steigen können. Alle Maßnahmen die am Wärmenetz vorgenommen werden sollten im Betriebsbuch vermerkt werden. Gerade die Menge und Qualität des Nachspeisewassers sollte genau dokumentiert werden.
In welchen Abständen sollten die Werte überprüft werden:
Die VDI 2035 empfiehlt die Kontrolle des Heizungswassers mindestens einmal im Jahr.
Was sollte man unternehmen, wenn die gemessenen Wasserparameter nicht den Vorgaben entsprechen:
Es gibt verschiedenste Maßnahmen, die ergriffen werden können. Hier sollte aber der Rat eines Fachmannes eingeholt werden und wichtig ist immer der Einzelfall. Wichtig ist aber, dass dieser Fachmann auch alle Informationen erhält um die Werte interpretieren zu können. Nur dann können sinnvolle Maßnahmen empfohlen werden, die zum Wärmenetz passen.
3. Merkblatt Überwachung der Wasserqualität bei Wärmenetzen
Befüllung/Fahrweisen:
Wasseraufbereitung ohne chemische Zusätze (salzarme Fahrweise):
Die Korrosionsverzögerung bei der Wasseraufbereitung ohne chemische Zusätze, wird hauptsächlich über die elektrische Leitfähigkeit gesteuert. Je niedriger die elektrische Leitfähigkeit, desto langsamer laufen Korrosionsprozesse ab. Diesen Effekt erreicht man hauptsächlich durch die Entnahme der Mineralsalze aus dem Wasser. Man spricht hier von demineralisiertem Wasser.
Die Grundlage der korrosionsverhindernden Wasseraufbereitung ohne chemische Zusätze ist aber dass der Sauerstoffgehalt gewisse Grenzen nicht überschreitet und dass es sich um ein geschlossenes System handelt (keine ständigen Sauerstoffeintritte). Korrosionsreaktionen in Wärmenetzen werden wesentlich durch die Menge des im Wasser gelösten Sauerstoffes bestimmt. Es ist daher darauf zu achten, dass die Sauerstoffkonzen-tration in allen Teilen eines Wärmenetzes so niedrig wie möglich gehalten wird. Ein ständiger Sauerstoffeintrag ist zu vermeiden. Regelmäßige Messungen des gelösten Sauerstoffes (alle 4 Wochen) im Füllwasser sind zu empfehlen.
Die Werte sollten nicht schwanken, da ansonsten von ständigen neuen Sauerstoffeinträgen auszugehen ist.
Die VDI2035 Blatt2 gibt hier folgende Empfehlungen ab:
Variante 1: Salzhaltige Fahrweise (über 100 μS/cm) = gelöster Sauerstoff in mg/l < 0,02
Variante 2: Salzarme Fahrweise (unter 100 μS/cm) = gelöster Sauerstoff in mg/l < 0,1
Die salzarme Wasserqualität, in Verbindung mit dem geringen Sauerstoff im Wasser, verzögert unter anderem folgenden Schäden (VDI 2035 Blatt 2) bei Wärmenetzen und Kältenetzen:
• gleichmäßige Flächenkorrosion • Lochkorrosion • Bimetallkorrosion • Spaltkorrosion
• Korrosion unter Ablagerungen • Wasserlinienkorrosion • selektive Korrosion • Erosionskorrosion
• Kavitationskorrosion • Spannungsrisskorrosion • mikrobiell beeinflusste Korrosion (MIC)
Biofilme können auch bei hohen Temperaturen entstehen. Biofilme können in Heizungsanlagen die Effizienz von Wärmeübertragungsvorgängen (extrem niedrige Wärmeleitfähigkeit der Biofilme) und außerdem die Korrosion der Werkstoffe beeinflussen. An der Grenze von Biofilm und Werkstoff können sich korrosionsfördernde Bedingungen ausbilden. Dieser Effekt wird als „mikrobiell beeinflusste Korrosion“ (MIC) bezeichnet. Biofilme können in der Regel nur mit chemischen Mitteln beseitigt werden.
Diese salzarme Fahrweise ist hauptsächlich für neu gebaute, geschweißte Wärme und Kältenetze geeignet, die hauptsächlich Eisen und unlegierten Stahl als Material verwenden. Die salzarme Fahrweise sollte direkt bei der Inbetriebnahme angewendet werden. Das Netz sollte vor der Inbetriebnahme ausreichend gespült werden.
Einsatz von chemischen Inhibitoren als Korrosionsschutz:
Immer wenn das Wärmenetz oder Kältenetz nicht sauerstoffarm betrieben werden kann, oder wenn sich bereits größere Korrosionsanschübe z.B. durch unsachgemäße Wasseraufbereitung gebildet haben ist ein Korrosionsschutz über die elektrische Leitfähigkeit nicht sinnvoll. Dann sollten breitbandige (filmbildend, Härtestabilisierend, dispergierend, ph-Wert stabilisierend) Korrosionsschutzmittel zum Einsatz kommen. Diese schützen die Materialen wie ein „Innenlack Bezug“. Vor dem Einsatz dieser Mittel sollte das Netz chemisch gebeizt (entschlammt) und ausreichend gespült werden. Die Konzentration der Korrosionsschutzmittel sollte immer optimal gehalten werden.
Allgemeine Information und Hinweise bezüglich Wasserwerten und Korrosion:
Härte (Calcium und Magnesium): Fällt als Belag auf den Innenoberflächen der Materialien aus und führt zu Wirkungsgradeinbußen und hydraulischen Problemen. Die gemessene Härte wird als Resthärte bezeichnet, da der größte Teil der eingebrachten Härte bereits als Beläge ausgefallen ist.
pH-Wert: Ein ungünstiger pH-Wert (zu hoch/zu niedrig) führt, abhängig von den eingesetzten Materialien zu Korrosionen und oder Materialschädigungen. Der pH Wert ist aber nur eine Einflussgröße für die Korrosionsgeschwindigkeit. Ein optimaler pH Wert schützt alleine nicht vor Korrosion.
Elektrische Leitfähigkeit: Eine hohe elektrische Leitfähigkeit des Heizungswassers beschleunigt bzw. fördert Korrosionsvorgänge, wenn keine korrosionshemmenden chemischen Inhibitoren zugesetzt wurden. Korrosionshemmende chemische Inhibitoren sind in der Regel filmbildende Korrosionsschutzmittel.
Zink: Auch geringe gelöste Mengen an Zink im Wasser zeigen dass sich grundsätzlich eine Entzinkung der eingebauten verzinkten Komponenten ergibt. Das entzinkte Material neigt dann zu sehr schneller Korrosion, da die Schutzschicht fehlt. Das Zink, das dann im Wasserkreislauf vagabundiert, neigt dazu sich an anderen heißen Metallen abzulegen (z.B. Wärmetauscher) und kann so eventuelle Funktionsstörungen hervorrufen.
Regelmäßige Überwachung der Wasserparameter:
Es wird empfohlen die Wasserqualität mittels einer Laboranalyse mindestens einmal im Jahr überprüfen zu lassen. Die Konzentration etwaig eingesetzter chemischer Inhibitoren sollte mit überprüft werden.
Regelmäßig, mindestens alle 6 Monate sollte der ph-Wert, die elektrische Leitfähigkeit und der gelöste Sauerstoff vor Ort gemessen werden (mobile Messgeräte)
Reduzieren der Nachspeisemengen:
Die Menge der empfohlenen Nachspeisemenge an Füllwasser, während der Lebenszeit wird in der VDI 2035 mit 10% bezogen auf das Anlagenvolumen empfohlen. Es ist zu bedenken, dass mit jeder Nachfüllung Sauerstoff in das System gebracht wird. Besonders automatische Nachfüllsysteme sind anfällig für Fehlerquellen und Speisen dann ohne Grund regelmäßig Wasser nach. Dies sollte vermieden werden.
Führen eines Betriebsbuches:
Alle Maßnahmen am Wärmenetz oder Kältenetz sollten dokumentiert werden. Es sollten die Mengen des Nachspeisewassers und die Wasserparameter dokumentiert werden.
Wir verstehen uns als Qualitätspartner des SHK Handwerks und deren Kunden.
Wir sind mit den speziellen Gegebenheiten und Anforderungen dieser Branchen vertraut. Unsere Produkte und Dienstleistungen sind an den Bedürfnissen der einzelnen Zielgruppen ausgerichtet. Wir denken in Lösungen und sind daher der kompetente Ansprechpartner vor Ort, wenn es um Wasser, als Energieträger geht.
4. FAQ Angebote
Was ist ein Angebot
Aus rechtlicher Sicht ist ein Angebot eine Willenserklärung, in der ein Anbieter (Lieferant) seine Bereitschaft erklärt, einem anderen Unternehmen oder einer Person bestimmte Waren und Dienstleistungen zu bestimmten Bedingungen zu liefern oder zu erbringen.
Unser Angebote sind stets freibleibend.
Wie sind die Abrechnungsmodalitäten?
Beim Kauf unserer Produkte rechnen wir laut dem Angebot ab.
Bei Dienstleistungen sind die angegebenen Mengen nur Schätzungen unter Berücksichtigung vergleichbarer Objekte. Unser Angebot ist kein Werkvertrag sondern eine Dienstleistung und wird nach Aufwand abgerechnet.
Welche Zahlungsmöglichkeiten gibt es?
Wir bieten folgende Zahlungsmöglichkeiten an:
- Vorauskasse
- Sofort nach Erhalt der Rechnung
- 14 Tage nach Erhalt der Rechnung
- 30 Tage nach Erhalt der Rechnung, vorbehaltlich der Zustimmung unseres Factoring-Partners
Gibt es einen Unterschied zwischen Angeboten für Waren und Dienstleistungen?
Bei Angeboten für Waren steht die Menge der zu liefernden Waren fest.
Bei Dienstleistungen sind die angebotenen Mengen geschätzt, auf Grundlage ähnlicher Objekte und können je nach der Situation vor Ort davon abweichen. Die Abrechnung erfolgt nach Aufwand, kein Werkvertrag.
Wie geht es weiter wenn ich das Angebot erhalten habe?
Bei Angeboten zu unseren Produkten können Sie einfach bestätigen, dass Sie unser Angebot annehmen.
Bei Dienstleistungen wird sich einer unserer Kollegen noch bei Ihnen melden, um weitere technische Details und die Zahlungsweise zu klären.
Was geschieht, wenn sich die Grundlagen des Angebots ändern?
Bitte melden Sie sich bei uns und wir erstellen Ihnen ein neues Angebot.
Was passiert wenn Sie das Angebot ablehnen?
Sie können das Angebot jederzeit ohne weitere Folgen nicht annehmen.
Gibt es eine Gültigkeitsdauer für das Angebot?
Unsere Angebote sind freibleibend und haben eine Gültigkeit von 28 Tagen.
Kann ich Informationsmaterial erhalten?
Ja, auf unserer Webseite stehen Downloads von Infoblättern als PDF und verschiedene Videos zur Verfügung. Die Links finden Sie im Angebot.
Können Angebote individuell angepasst werden?
Wir können Ihr Angebot jederzeit an Ihre Bedürfnisse anpassen.
Wie genau sind die im Angebot enthaltenen Schätzungen?
Die Schätzungen können nur nach Ihren Angaben und ähnlichen Objekten abgegeben werden. Je genauer Ihre Angaben z.B. über den Verschmutzungsgrad der Anlage sind, desto genauer sind auch die Mengenangaben. Eine genaue Angabe der Mengen ist jedoch nicht möglich.
Wo melde ich mich wenn ich noch Fragen habe?
Auf dem Angebot ist auch immer eine Kontaktperson angegeben. Wir freuen uns, Ihre Fragen zu beantworten.
Gelten mündlich gemachte Zusagen?
Nein, alle Zusagen die unsere Mitarbeiter mündlich gemacht haben, müssen von uns schriftlich bestätigt werden.
Welche rechtlichen Bedingungen gelten für das Angebot?
Da unsere Angebote freibleibend sind, verpflichten sie uns rechtlich nicht zur Vertragserfüllung. Erst durch Ihre Bestellung und die Auftragsbestätigung kommt ein Vertrag zustande.
5. FAQ zum weiteren Vorgehen nach Bestellung und Auftragsbestätigung bei nicht oline getätigten Bestellungen
Was geschieht nach Erhalt der Auftragsbestätigung?
Nach Erhalt der Auftragsbestätigung wird der Kaufvertrag rechtlich bindend.
Was für Verträge werden bei Arbeiten abgeschlossen?
Wir schließen ausschließlich Dienstleistungsverträge ab. Werkverträge sind ausgeschlossen. Die angegebenen Mengen dienen als Schätzung, und die Abrechnung erfolgt gemäß dem tatsächlichen Aufwand.
Was passiert, wenn es zu Unstimmigkeiten in der Auftragsbestätigung kommt?
Bei Unstimmigkeiten oder Fehlern in der Auftragsbestätigung kontaktieren Sie bitte umgehend Ihren Ansprechpartner, damit wir eine Korrektur vornehmen können.
Kann ich meine Bestellung stornieren oder ändern?
Unsere Stornogebühren für bestätigte und terminierte Lieferungen von VE-Wasser im Tankwagen oder IBC lauten:
35% des Auftragsvolumens Bearbeitungsgebühr bei Stornierung 72h vor Lieferung
50 % des Auftragsvolumens Bearbeitungsgebühr bei Stornierung 48h - 25h vor Lieferung
100 % des Auftragsvolumens Bearbeitungsgebühr bei Stornierung 24h vor Lieferung (Tag der Beladung)
Die Stornogebühren beinhalten u.a. Ausfallfracht, Leerkilometer, Neuorganisation der Rückladung etc.
Bestellugnen, die nicht bestätigt wurden, können jederzeit kostenlos stroniert werden.
Als Berechnungsgrundlage der Stornogebühren dienen nur die Tage Montag bis Freitag.
Unsere Stornogebühren für bestätigte Dienstleistungen:
Beendet der Kunde das Vertragsverhältnis, ohne dass dies von Alpenland zu vertreten ist, so kann Alpenland ohne besonderen Nachweis eine Entschädigung in Höhe von 45% des Nettoauftragswertes beanspruchen, sofern im Einzelfall Alpenland nicht einen höheren Schaden nachweisen kann.
Wie werden Änderungen im Auftragsumfang behandelt?
Sprechen Sie mit Ihrem Ansprechpartner der auf der Auftragsbestätigung vermerkt ist. Sollte es noch möglich sein, werden wir selbstverständlich Ihren Wünschen entgegenkommen.
Was passiert, wenn sich die Lieferzeiten ändern?
Sollte es einmal zu Verzögerungen bei der Lieferung kommen, werden Sie von uns über den neuen Termin informiert.
Welche Schritte sollten unternommen werden, wenn zusätzlich Anforderungen entstehen?
Sprechen Sie mit dem Ansprechpartner der auf Ihrer Auftragsbestätigung vermerkt ist, dann erhalten Sie ein neues Angebot mit den zusätzlichen Produkten oder Dienstleistungen.
Wie wird mit fehlerhaften oder unvollständigen Lieferungen umgegangen?
Sie können Ihre Beschwerde auf verschiedenen Wegen einreichen: per E-Mail oder telefonisch. Die Beschwerde ist sofort einzureichen, spätestens jedoch am nächsten Morgen.
Gelten auch mündliche Vereinbarungen?
Mündliche Vereinbarungen und Zusagen sind nicht bindend. Sie bedürfen grundsätzlich einer schriftlichen Bestätigung.
Wie wird die Arbeit dokumentiert?
Wir dokumentieren täglich unsere Arbeiten. Sie erhalten täglich einen Link zur Bestätigung dieser Arbeiten, die bis spätestens 10:00 Uhr am Folgetag erfolgen muss. Ohne diese Bestätigung wird die Arbeit nicht fortgesetzt, jedoch fallen Ausfallzeiten an, die zu vergüten sind.
Wie erfolgt die Abrechnung?
Die Abrechnung auf Baustellen erfolgt wöchentlich oder sofort nach Beendigung der Arbeiten gemäß der in der Auftragsbestätigung festgelegten Zahlungsweise.
Produkte werden bei Warenausgang berechnet.
Wochenendarbeit?
Wochenendarbeit ist nach Absprache und Bedarf möglich.
Wie verfahre ich bei einer Beschwerde?
Bei Unzufriedenheit mit der geleisteten Arbeit, melden Sie dies bitte bis spätestens 12:00 Uhr am Folgetag telefonisch oder per Mail an Maximilian Sonnert.
Tel: 0178 1198 515
E-Mail: [email protected]
Beschwerden nach dieser Frist können leider nicht mehr berücksichtigt werden.
An wen wende ich mich bei Fragen zu meiner Bestellung?
Bei Fragen zu Ihrer Bestellung / Auftrag wenden Sie sich dirket per E-Mail oder telefonisch an uns.
6. Beschwerdemanagement
Was genau versteht man unter Beschwerdemanagement?
Unter Beschwerdemanagement verstehen wir alle Maßnahmen und Prozesse, die darauf abzielen, Kundenbeschwerden effektiv zu behandeln, um die Kundenzufriedenheit zu verbessern und mögliche Probleme in unseren Produkten oder Dienstleistungen zu identifizieren und zu lösen.
Wie kann ich eine Beschwerde bei Ihrem Unternehmen einreichen?
Sie können Ihre Beschwerde auf verschiedenen Wegen einreichen: per Mail oder telefonisch. Die Beschwerde ist sofort einzureichen, spätestens jedoch am nächsten Morgen.
Welche Arten von Beschwerden können eingereicht werden?
Wir nehmen alle Arten von Beschwerden einschließlich Produktfehlern, Serviceproblemen und sonstigen Unannehmlichkeiten.
Welche Informationen sind bei einer Beschwerde anzugeben?
Bitte geben Sie Ihren Namen, Kontaktinformationen, Kaufdatum, Produkt oder Dienstleistung und eine klare Beschreibung des Problems an.
Wie lange dauert es, bis meine Beschwerde bearbeitet wird?
Wir bemühen uns, alle Beschwerden so schnell wie möglich zu bearbeiten. In der Regel erhalten Sie innerhalb von 2 Arbeitstagen eine erste Rückmeldung.
Wie stellen Sie sicher, dass meine Beschwerde vertraulich behandelt wird?
Ihre Privatsphäre ist uns wichtig. Alle Beschwerden werden streng vertraulich behandelt und nur von autorisiertem Personal bearbeitet.
Gibt es einen direkten Ansprechpartner für mein Anliegen?
Ja, nach Einreichung Ihrer Beschwerde wird ein Mitglied unseres Kundenservice-Teams Ihr direkter Ansprechpartner sein und Sie durch den Prozess begleiten.
Wie gehen Sie mit negativem Kundenfeedback um?
Wir sehen negatives Feedback als Chance zur Verbesserung. Wir nehmen jede Rückmeldung ernst und nutzen sie, um unsere Produkte und Dienstleistungen kontinuierlich zu verbessern.
Welche Schritte unternimmt Ihr Unternehmen, um das Problem zu lösen?
Nachdem wir Ihre Beschwerde erhalten und analysiert haben, entwickeln wir einen Aktionsplan, der sowohl kurzfristige Lösugen als auch langfristige Verbesserungen beinhalten kann.
Wie werden die Mitarbeiter in Ihrem Unternehmen im Umgang mit Beschwerden geschult?
Unsere Mitarbeiter erhalten regelmäßige Schulungen im Beschwerdemanagement, um sicherzustellen, dass sie kompetent und empathisch auf Kundenanliegen eingehen können.
Hinweis:
Wir beliefern ausschließlich Gewerbetreibende und wir betreuen den Betreiber im Bereich der Füllwasseraufbereitung und Überwachung
immer in enger Kooperation mit dem vor Ort verantwortlichen Fachmann / Fachfrau.
Wir beliefern ausschließlich Gewerbetreibende und wir betreuen den Betreiber im Bereich der Füllwasseraufbereitung und Überwachung
immer in enger Kooperation mit dem vor Ort verantwortlichen Fachmann / Fachfrau.
Alpenlandheizungswasser KG
Terminalstraße Mitte 18 I 85356 München
[email protected]
Tel:: 0800 381 4202 I Fax: 0800 381 209
[email protected]
Tel:: 0800 381 4202 I Fax: 0800 381 209
Niederlassungen:
Hamburg: |
6th Floor / Millerntorplatz 1 20359 Hamburg |
Berlin: |
8th Floor / Europaplatz 2 10557 Berlin |
Dresden: |
Altmarkt 10D 01067 Dresden |
Wasserburg am Inn: |
Odelsham 10 83547 Babensham |
Oberviechtach: |
Schönseerstr. 45 92626 Oberviechtach |